Einen Schritt voran kommen – via Waldhaus
Anfragen & Angebote

Reif fürs Waldhaus?
Typen (w/m/d) gesucht.
Do it your way.
Du willst in deiner Arbeit deinen eigenen Weg gehen oder finden. Im Waldhaus kannst du jederzeit auf die Unterstützung erfahrener Kolleginnen und Kollegen zählen.
Aktuelles
Bleib auf dem Laufenden

Projekt „Last Minute Bewerbungstuning“ – Gelungener Bewerbungs-Aktionstag im LEO-Center
Am Samstag, den 13. April 2024, fand von 14 bis 19 Uhr das Projekt „Last Minute Bewerbungstuning“ im LEO-Center statt.

Die Politik bekommt einen Einblick in den Alltag der Jugendhilfe
Sozialdezernent Dusan Minic und Landtagsabgeordneter Peter Seimer verbrachten einen Vormittag bei der Waldhaus Jugendhilfe in Hildrizhausen im Rahmen des Projektes „Seitenwechsel“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Kreisverband Böblingen.

Schönbuch Talentshow 2024
Singen, tanzen, performen…was ist dein Talent?
Wir suchen DICH für die Schönbuch Talentshow am 03.05.2024 im Jugendhaus W3 in Holzgerlingen.

Neue Waldhaus-Geschäftsführung
Seit Anfang des Jahres bilden Lisa Artschwager und Philipp Löffler im Übergang bis Juli 2024 gemeinsam mit Hans Artschwager die neue Geschäftsführung des Waldhauses.
Was für dich dabei?
Offene Angebote im Waldhaus
Ferienprogramme
Unsere Jugendreferate an 15 Standorten
Ausbildung? Praktika?
Hier findest du Orientierung
Kleiderwunsch
Hier kannst du Kleidung spenden
ehrenamtliches Engagement
Zur Juleica-Schulung
gegen Armut und Ausgrenzung
Zum Projekt SILKYplus in Leonberg
Waldhaus vor Ort
Die Übersicht über unsere Standorte
Hier findest du uns
Unser Stammgelände am Schönbuchrand in Hildrizhausen
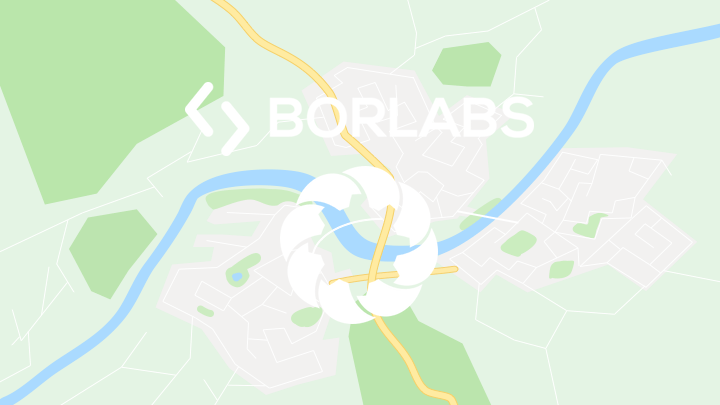
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Wir kümmern uns um die Erwachsenen von morgen
DAS WALDHAUS
SEIT 1957
Sozial. Engagiert. Verantwortungsbewusst.
Wir kümmern uns seit 1957 um die Belange von Jugendlichen und jungen Familien.
Kohltor 1-9
71157 Hildrizhausen
Tel.: (07034) 93 17 – 30
info@waldhaus-jugendhilfe.de
